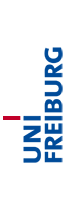Volker Michael Strocka: Hundert Jahre Archäologisches Institut an der Universität Freiburg*
Über 100 Jahre einer akademischen Institution zu sprechen, an der man selber kaum den zehnten Teil verbracht hat, ist ein schwieriges Unterfangen. Bei der Nachforschung nach Charakter und Wirken der Vorgänger, der Entwicklung der Einrichtung und der Wirkung des Fachs stößt man rasch auf die Problematik von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die im Freiburger Sonderforschungsbereich so erfolgreich untersucht wird. Die mündliche Überlieferung reicht nicht weit zurück, wichtige Augenzeugen wie Frau Schuchhardt oder mein Kollege Eckstein, die ich jetzt gerne befragt hätte, sind unlängst gestorben. Die Akten im Universitätsarchiv weisen andererseits große Lücken auf oder berichten nur äußerliche Daten und Umstände, die wenig vom Geist der Wissenschaft und dem Umgang von Professoren und Studenten verraten1. Obwohl ich vieles nicht herausgebracht habe und auch viel mehr Zeit hätte aufwenden sollen, um weitere Auskünfte zu sammeln, schien es mir doch lohnend, einiges von dem Gelesenen Ihnen heute mitzuteilen.
Bei dieser Rückschau hat es mich sowohl belustigt wie getröstet, daß die menschlichen Charaktere und die strukturellen Probleme eines Instituts sowie der Verteilungskampf um immer zu geringe Mittel sich imgrunde gleich geblieben sind. Die geistigen Ereignisse im Gespräch, in Seminar und Vorlesung, in den veröffentlichten Werken als Frucht oft langjähriger mühevoller Arbeit sind kaum zu fassen und darzustellen. Dennoch bilden gerade sie und nur sie Ziel und Sinn all der äußeren Ereignisse, von denen vorwiegend zu berichten sein wird.
Aus der Einladung haben Sie entnommen, weshalb wir ausgerechnet heute, am 19. Februar 1991, die ersten hundert Jahre des Archäologischen Instituts begehen: An diesem Tag wurde der schon 1889 zum außerordentlichen Professor für Klassische Archäologie berufene Franz Studniczka zum Ordinarius ernannt und damit das Archäologische Institut die selbständige Einrichtung, die es seitdem geblieben ist.
Die Beschäftigung mit antiker Kunst reicht an der Freiburger Universität wenigstens 200 Jahre zurück. Vielleicht angeregt vom Mannheimer Antikensaal, der schon Herder und Goethe begeisterte oder allgemein unter Winckelmanns ungeheurem Einfluß hatte man bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bereits einige wichtige Gipsabgüsse angeschafft, bezeichnenderweise jedoch weniger zum Studium der antiken Plastik, einem späteren Leitmotiv der Freiburger Archäologie, sondern für den Zeichenunterricht der Studenten. Neben einem Tanzmeister und einem Fechtmeister bezahlte die Universität - vermutlich schlecht - auch einen Zeichenlehrer, der den Studenten der Philosophischen Fakultät wohl die Anfangsgründe der wahren Schönheit und der edlen Kunst beibringen sollte. Diese Abgüsse waren im unteren Stock des alten Bibliotheksgebäudes untergebracht, wurden aber 1821 wegen der notwendigen Erweiterung der Bibliothek daraus vertrieben2 - typisches und später wiederholtes Schicksal von Abgußsammlungen, die als bloße Medien des Kunstschönen in harten Zeiten immer den näherliegenden Notwendigkeiten weichen mußten. Schon 1779 hatte die Universität von dem Regierungs- und Kammerrat von Greiffeneck eine Sammlung römischer Münzen um den Preis von 150 Dukaten gekauft und damit den Grund zu dem sog. älteren akademischen Münzkabinett gelegt, dessen Bestand durch Schenkungen von Professoren und 1858 des Freiherrn von Prokesch-Osten nicht unwesentlich vermehrt wurde. 1832 wurde sogar die Lippertsche Daktyliothek für mehr als 300 Gulden angeschafft3. Wo sie und die alten Münzen geblieben sind, ist mir noch unbekannt.
1986 hätten wir 150 Jahre Archäologisches Institut feiern können, denn 1836 wurde Anselm Feuerbach als Ordentlicher Professor der alten Sprachen und Altertumskunde nach Freiburg berufen. Da jedoch nach seinem 1851 erfolgten Tod die Stelle 38 Jahre lang vakant blieb, man von einer möglichen Tradition also nicht sprechen kann, haben wir dieses Datum lieber verstreichen lassen. Anselm Feuerbach4 wurde am 9. September 1798 in Jena geboren und kam schon als Kind viel herum, weil sein Vater Paul Johann Anselm Feuerbach, ein bedeutender Jurist, seinen erfolgreichen Weg nach oben über viele Stationen zurücklegen mußte. Feuerbachs Vater war äußerst ehrgeizig, vital und impulsiv und sicherlich für seine Familie, besonders die begabten acht Kinder ebensosehr eine Herausforderung wie eine Bedrückung. Unter Anselms Geschwistern ragen der Mathematiker Karl Feuerbach und der Philosoph Ludwig Feuerbach hervor. Anselm muß eine sehr anregende Kindheit und Studentenzeit gehabt haben, die bis zur Bekanntschaft mit Goethe und Jean Paul reichte. Aber er war ein übersensibles, in sich zerrissenes Wesen, das zeit seines Lebens an einer zunehmenden Nerven- und Gemütskrankheit litt, die ihm, seiner Familie und sicherlich auch seinen Kollegen zur Qual werden mußte. Gustav Radbruch schreibt in einem sehr lesenswerten Artikel über »die geistige Dynastie der Feuerbachs«, dessen Kenntnis ich Herrn Prorektor Hollerbach verdanke, zu Anselm: Er war »wie ernste und satirische Dichtungen im Geistes des ihm befreundeten Platen beweisen, dichterisch begabt, er war durch und durch musikalisch und war vor allem auch ein guter Zeichner. Er gehörte zu jenen künstlerisch Empfindenden, deren Begabung zwar für den künstlerischen Beruf nicht ausreicht, die aber die Kunst zum Gegenstand ihres wissenschaftlichen Forschens machen und dabei ihren wissenschaftlichen Schöpfungen zugleich den Adel eines Kunstwerks aufzuprägen vermögen. In guten Zeiten war er ein glänzender Gesellschafter, im Gespräch niemals unbedeutend, voll originellem Humor und geistreichem Witz und von formgeprägter Sprache. Aber, >ein Wort, ein Blick, durch welchen der Dämon des Mißtrauens geweckt wurde - und die Verstimmung bemächtigte sich seines ganzen Wesens; dann war es eine Qual und eine Bitterkeit, die ihn rastlos in sich selbst umherjagte«<5. Anselm Feuerbach studierte 1816-19 in Erlangen, 1820-22 in Heidelberg, wo zu seinen Lehrern Voss, Kreutzer und Schlosser gehörten. Nach schwerer Krankheit legte er dann 1825 die große Staatsprüfung in München mit dem besten Prädikat ab und fand im selben Jahr eine Anstellung als Philologe am Gymnasium zu Speyer. Im Herbst 1826 heiratete er die Ansbacherin Amalie Keerl und verlebte eine zunächst glückliche Zeit in Speyer. 1827 wurde eine Tochter geboren, 1829 ein Sohn Anselm, der spätere große Maler. Schon 1830 starb seine Frau, womit für Feuerbach zunächst die Welt zusammenzubrechen schien. Der Kinder und seiner selbst nahm sich schließlich Henriette Heydenreich an, die er 1834 heiratete. Seit er in Speyer zunächst freudig, dann immer lustloser am Gymnasium tätig war, beschäftigte ihn der »Vaticanische Apoll«, eine umfassende Monographie der Statue im Belvedere des Vatikan, das einzige zu seinen Lebzeiten erschienene Buch, das dann ein überwältigender Erfolg wurde6. Wie so oft in Gelehrtenfamilien wurde der geistige Gegenstand zum Alb der Angehörigen: »Ach wenn nur der mächtige Apollo einmal unser Hüttchen räumen und in die Druckerei sich begeben wollte« klagte seine Frau Amalie in einem Brief an ihre Mutter7. Ein Ruf nach München als Nachfolger Schorns scheiterte daran, daß der König die Stelle nicht wieder besetzen wollte. Einen Ruf nach Dorpat mußte Feuerbach wegen der zarten Gesundheit seiner Kinder abschlagen. Der 1833 erschienene »Vaticanische Apoll« veschaffte ihm aber dann den Ruf nach Freiburg. In seinem Gutachten über die verschiedenen Bewerber schrieb der scheidende Professor Zell8: »3. Professor Feuerbach. Das vorliegende Werk desselben über den Vatikanischen Apoll zeigt von Seiten seines Verfassers Geist, Genialität, ausgezeichnete Darstellungsgabe, lebendige und selbständige Auffassung des Altertums, besonders von der ästhetischen Seite, reiche und wohl angewendete Kenntnisse in dem speziellen Fache der Kunstgeschichte, Kenntnis der alten klassischen Literatur und eindringende selbständige Studien in einzelnen Teilen derselben.« Die Philosophische Fakultät berief ihn daraufhin und stellte den Antrag, »die Gymnasialproff. Anselm Feuerbach in Speyer und Anton Baumstark in Freiburg, beide als proff.ord. der alt-clas-sischen Philologie und Archäologie an hiesiger Hochschule anzustellen, und zwar jenen vorzugsweise für die zur allgemeinen classisch-philologischen Bildung gehörenden Lehrzwecke, diesen aber unter Ernennung zum Direktor des Philologischen Seminars, insbesonders für den philologisch-technischen und practischen Unterricht.« Das Ministerium verlangte jedoch eine abwechselnde Direktion, wobei Feuerbach mit 1200 Gulden im Jahr das weitaus größere Gehalt bezog, während Baumstark bis 1849 weiter am Gymnasium tätig war und für fünf Wochenstunden an der Universität nur 450 Gulden bezog. Konflikte zwischen dem, wie schon sein Name sagt, anscheinend recht vitalen Baumstark und dem überempfindlichen Feuerbach blieben nicht aus. Schon bei Baumstarks Antrittsvorlesung im Dezember 1836 fühlte sich Feuerbach in seiner Fachrichtung und persönlich schwer beleidigt und verschob jahrelang seine eigene Antrittsvorlesung wegen der Bedingung einer Satisfaktion, die er wohl kaum erlangte. Baumstark verteidigte sich gegenüber Fakultät und Senat damit, er habe nur von der (natürlich von ihm vertretenen) »wahren Philologie« gesprochen! Diese Mißhelligkeiten am Philologischen Seminar überschatteten Feuerbachs gesamte Freiburger Zeit. Ein Lichtblick war seine 1839-1840 unternommene Italienreise, auf die er jahrelang hingearbeitet und gespart hatte. Wunderschöne Briefe an seine Frau sind erhaltengeblieben. Ich zitiere aus einem mich natürlich besonders berührenden Brief vom 20. Oktober 1839, in dem er über seinen Besuch Pompejis berichtet: »... bald dann, durch die Gräber immer höher steigend, das Stadttor und die erste eigentliche Straße von Pompeji. Der Rückblick ist wunderbar ergreifend. Ebenso der Blick hinab, wo die Straße sich wieder senkt, und doch verschwindet jedes Gefühl des Tragischen; man fühlt nur eine Stille, feierliche Heiterkeit. Die Häuser sind so niedlich, die Gemächer so traulich, die Farben der Gemälde frisch, die Darstellungen bald mythisch, bald phantastisch, bald häuslich, so daß man noch mit einem lebensfrohen, feinsinnigen Volke zu verkehren meint. Dort schweben tanzende Musen über die rote Zimmerwand, dort Amoretten. Ariadne blickt nach dem scheidenden Theseus, und Iphigenia findet ihren Bruder wieder ... Es ist eine stille Seligkeit, in dieser fremden und doch so längst bekannten, vertrauten Welt umherzuwandeln. Meine Mittagstafel, aus Brot und lacrimae Christi-Weine bestehend, hielt ich auf einem Säulenkapital, in wunderseltsame Träumereien vertieft, und ging in der heiligen Abendstille der sonntäglichen Natur dann auch still und einsam durch die Gräberstraße zurück.«9 Wie weit entfernt sind wir von dieser romantischen Erlebnisfähigkeit! Wenn anderthalb Jahrhunderte später wieder ein Freiburger Professor in Pompeji herumgeht, so leitet er eine nüchterne Mannschaft aus Archäologen, Photogrammetern, Photographen, Graphikern, Architekten und Restauratoren, die den heruntergekommenen Resten die letzten Lebenszeichen entlocken, meidet die im Jahr nach Millionen zählenden Touristenherden und hat für die brutal zersiedelte Landschaft nur mehr bittere Worte. Wie seine Frau Henriette überliefert, kehrte Anselm Feuerbach »im Mai 1840 ... über Genua und Turin nach Freiburg zurück, mit einem Reichthum von wissenschaftlichen Schätzen, welche von einem wahrhaft übermäßigen Fleiße Zeugniß geben. Leider ist von diesem herrlichen Vorrath an Ausarbeitungen, Notizen und Zeichnungen, außer einer Reihe von Abhandlungen über die etruskischen Gräber im Kunstblatte, nur sehr wenig bekannt geworden«.10 Ob es diesen kostbaren Nachlaß noch irgendwo gibt,konnte ich ebenfalls bisher nicht herausfinden. Die Reise muß Feuerbach sehr angestrengt haben, jedenfalls ging es ihm hinterher nicht besser, eher schlechter. Noch einmal möchte ich Henriette Feuerbach die ihn Stützende und zugleich an ihm Leidende zu Wort kommen lassen: »Ob es bloß Krankheit ist, ob Gewohnheit, kann ich nicht beurteilen, ich fürchte, beides. Er hält seine Kollegien, sitzt den ganzen Tag am Arbeitstisch, bringt aber leider nichts zusammen. Gegen Fremde versteht er sich zusammen zu nehmen und etwas vorzustellen, zuhause aber ist er völlig in sich versunken, stumm teilnahmslos, oft können mehrere Tage vergehen, ohne daß es nur möglich ist, eine Antwort aus ihm herauszubringen«11. Feuerbachs Zustand verschlimmerte sich von Jahr zu Jahr, bis er 1847 um Urlaub wegen Krankheit eingeben mußte, der immer wieder verlängert wurde. Kurz nach seiner krankheitsbedingten Pensionierung verstarb er am 7. September 1851. Das Ministerium war offenbar durch die Zwiste am Philologischen Seminar und die langen Jahre umsonst gezahlter Bezüge so verärgert, daß Feuerbachs Stelle und damit die Klassische Archäologie bis zu Studniczkas Archäologie, die sich von der Archaik bis zu den Werken der römischen Provinz für alles interessierte und durch nüchterne Analyse und scharfsinnige Kombination von Schriftquellen und Sachquellen erstaunliche Erfolge zeitigte. Franz Stud-niczka ist neben vielem anderen die Identifizierung der Antenor-Kore ebenso wie der Porträts des Aristoteles und des Menander zu verdanken. Für ihn war die rekonstruierende Beschäftigung mit Originalen und Abgüssen selbstverständlich. Besonders nach seinem 1896 erfolgten Ruf an die ungleich bedeutendere Universität Leipzig machte er aus der dortigen Archäologischen Sammlung ein großartiges Arbeitsinstrument. Die bedeutendsten Archäologen der nächsten Generation waren seine Schüler. In Freiburg hatte er wenigstens einen später hochbedeutenden Schüler, nämlich Theodor Wiegand, der 1891 hierher kam, um zwei Jahre später »multa cum laude« zu promovieren. Carl Watzinger schreibt in seiner Wie-gand-Biographie über diese für Wiegand so wichtige Zeit: »Er fand hier in Ernst Fabricius und Franz Studniczka die beiden Lehrer, die nach Dörpfeld und Puchstein seine weitere Entwicklung als Archäologe entscheidend beeinflußt haben. Als älterer Student und reiferer Mensch, zugleich als einziger Archäologe trat er, wie es an einer kleineren Universität leichter möglich ist, rasch zu beiden in ein nahes, persönliches Verhältnis ... Besonders warm und herzlich hat sich Franz Studniczka seiner angenommen. Im ersten Semester hat Wiegand jeden Donnerstagabend bei ihm zugebracht und alle wissenschaftlichen Fragen, die ihn beschäftigten, mit ihm besprechen können. Studniczka zog ihn auch zu Arbeiten im Institut heran, ließ ihn die kleine Originalsammlung inventarisieren und übertrug ihm später auch die Katalogisierung der Sammlung antiker Münzen. Ihm verdankte Wiegand auch die Anregung, sich mit der Bauinschrift von Puteoli zu beschäftigen, einer lateinischen Urkunde über den Bau eines Tores, aus der die Dissertation erwuchs ... Studniczka, der an seine Schüler die höchsten Anforderungen stellte, hat diese Arbeit mit seinem Rat und seiner Kritik begleitet, unermüdlich auch das Kleinste nicht übersehen ... Das überlegene Wissen des Lehrers, der keine Oberflächlichkeit duldete und mit ungeheurer Gelehrsamkeit eine allseitige Durchdringung des Stoffes verlangte, ist von seinem Schüler oft drückend empfunden worden; dieser hat zeitweise unter der scharfen und harten Zucht, die auf ihm lastete, das Gefühl der eigenen Minderwertigkeit so stark empfunden, daß er jedes Selbstvertrauen verlor und von selbstquälerischen, bis zum Lebensüberdruß führenden Gedanken ergriffen wurde. >Studniczka hat mich erzogen, aber im Augenblick hat er mich totgedrückt<, heißt es u.a. im Tagebuch16.« Um die Freiburger Sammlung scheint sich Studniczka sehr bemüht zu haben. Am 13. Februar 1891 bereits wurde sein Antrag auf einen außerordentlichen Zuschuß von 4000 Mark für Institut und Sammlung durch die Fakultät befürwortet. Anscheinend wurde er aber nicht bewilligt, eine häufige Erfahrung; ein Erlaß des Ministeriums vom 5. Mai 1896 erhöhte zwar das Aversum von 1200 Mark auf 2000 Mark, davon aber waren 800 Mark für »neuere Kunstgeschichte« vorgesehen, die ja erst sehr viel später zu einem Ordinariat kam. De facto also wurde das Aversum für die Archäologen nicht erhöht. Dafür gab es 700 Mark zur Ergänzung der Abgußsammlung. Dieser Betrag ist freilich nicht ganz so klein, wie er heute wirken mag. Studniczkas Gehalt als Ordinarius betrug jährlich 3500 Mark 4- 760 Mark Wohngeld. Wenn man von heutigen Verhältnissen rückschließen darf, hatte demnach die Goldmark vor fast 100 Jahren eine 25- bis 30mal größere Kaufkraft als unsere Mark.
Nach Studniczkas Weggang wurde zum 1. Oktober 1896 Otto Puchstein als Ordentlicher Professor für Klassische Archäologie berufen17. 1856 in Labes in Pommern geboren, studierte Puchstein von 1875 bis 1879 bei Adolf Michaelis in Straßburg, wo er noch über ein philologisches Thema promovierte. Bedeutende Anregungen erfuhr er dann als Hilfsarbeiter bei den Königlichen Museen zu Berlin, indem er an der richtigen Zusammensetzung des Pergamon-Altars wesentlich beteiligt war, und zwischendurch als Stipendiat des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. Sein großes Interesse für die monumentale Architektur im Mittelmeergebiet und Orient und seine praktische, zupackende Art waren günstige Voraussetzungen für bis heute grundlegende Werke zur antiken Baugeschichte. So bearbeitete er als erster die Denkmäler des Nemrud Dag in der Osttürkei, sowie die griechischen Tempel in Unteritalien und Sizilien gemeinsam mit Robert Koldewey. Diese Untersuchung erschien 1899, als Puchstein bereits in Freiburg war. Von hier aus brach er auch zu der gründlichen Bauaufnahme der riesigen Ruinen von Baalbek (Libanon) auf, die mit kaiserlichen Mitteln seit 1900 durchgeführt werden konnte. Als Andenken von diesen Expeditionen bewahrt unsere Freiburger Archäologische Sammlung ja bis heute ansehnliche Trümmer der kaiserzeitlichen Architekturornamentik Baalbeks. Gleichzeitig war der vielseitige Puchstein auch Streckencommissarius der Limes-Kommission. Hat er 1904 noch die Leitung der römischen Abteilung des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts ausgeschlagen, so folgte er 1905 dem Ruf nach Berlin als Generalsekretär eben dieses Archäologischen Reichsinstituts. Diesen Wechsel auf einen ebenso anstrengenden wie undankbaren Posten kommentierte Puchsteins alter Bekannter Hermann Winnefeld, vielleicht von ihm selbst inspiriert, in einem Brief an Christian Hülsen in Rom so: »Euer neuer Generalsekretär ... scheint seiner Zukunft insofern beruhigt entgegenzusehen, als er das Bewußtsein hat, die größte Dummheit seines Lebens gemacht zu haben, so daß er sich vor einer weiteren nicht mehr zu fürchten braucht.«18 Immerhin konnte Puchstein von Berlin aus persönlich dafür sorgen, daß bei der Ausgrabung der soeben entdeckten hethitischen Hauptstadt Hattuscha-Bogazköy die architektonischen Denkmäler über den zahlreichen Keilschrifttexten nicht vernachlässigt wurden. 1911 ist er mit nur 55 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Ludwig Curtius, sein späterer Nachfolger in Freiburg und damals Grabungsassistent in Bogazköy lernte ihn 1907 dort kennen und charakterisierte ihn in seinen eigenen Lebenserinnerungen »Deutsche und antike Welt« wie folgt: »Otto Puchstein ... war eine der edelsten Persönlichkeiten unserer Wissenschaft. Er war ein großer, wohlgebauter, auf den ersten Anblick ausgesprochen männlich wirkender Mann, dessen lauteres Wesen sich nicht nur in einem gewissen Zögern seines Ganges, ja jeder seiner Gebärden, sondern auch in der verhaltenen, gleichsam jedes Wort noch auf der Zunge prüfenden Sprechweise verriet. Diese entsprang weniger einer gewissen Schwerfälligkeit, die zu dem Pommern gehörte, als der er sich mit Stolz fühlte, als einer höchsten sittlichen Wahrhaftigkeit, der alles Falsche, jede Halbheit oder Verschleierung, aber auch jede enthusiastische Übertreibung peinlich war und die daher, in die fortwährenden unvermeidlichen Konflikte des Lebens gestellt, sich nur zögernd entscheiden konnte.«19
Nach Puchsteins Abgang im Jahre 1905 wollte die Fakultät eigentlich Franz Winter aus Innsbruck oder Hans Dragendorff aus Frankfurt berufen. Man konnte sich »durchaus nicht entschließen, eine Auswahl unter den Gelehrten des Fachs zu treffen, welche wenig jünger sind als Winter und Dragendorff. Sie gehen - auch bei günstiger Beurteilung - nicht über das Mittelmaß hinaus.« Falls diese beiden ablehnen würden, was dann tatsächlich der Fall war, könne man nur unter den allerjüngsten, nämlich Thiersch und Delbrueck einen Nachfolger finden. Man entschied sich für Thiersch, und das Ministerium war sicher froh, ihm wegen seiner Jugend bis 1909 nur das Gehalt eines außerordentlichen Professors zahlen zu müssen. Hermann Thiersch, 1874 geboren, entstammte einer Münchner Gelehrten- und Architektenfamilie20. Er studierte Klassische Archäologie in München und Berlin und wurde 1898 bei Adolf Furtwängler, dem übrigens in Freiburg geborenen, damals wohl bedeutendsten Archäologen mit einer Arbeit zur archaischen griechischen Keramik promoviert. Anschließend war er zwar Assistent am Königlichen Antiquarium in München, doch viel auf Reisen, teils mit seinem Vater, teils als Stipendiat des Deutschen Archäologischen Instituts, vornehmlich in den Ländern des östlichen Mittelmeers. Er war an Ausgrabungen in Alexandrien ebenso wie in Pergamon und vor allem in Aigina beteiligt. 1904 in München mit einer Arbeit über »Zwei antike Grabanlagen bei Alexandria« habilitiert, kam er schon ein Jahr später nach Freiburg. Obwohl er als ao. Professor zunächst nur ein Jahresgehalt von 2500 Mark und 900 Mark Wohngeld erhielt, war doch die finanzielle Grundlage für seine Eheschließung mit Adelheid Eller aus Karlsruhe gelegt, die im selben Jahr erfolgte. Sechs Kinder sind aus dieser Ehe hervorgegangen. Die Freiburger Jahre Thierschs sind einerseits durch eine eifrige Publikationstätigkeit gekennzeichnet, andererseits durch eine rastlose und nur bedingt erfolgreiche Bemühung um die Verbesserung der Institutsausstattung. Neben Arbeiten zu Aigina, zum Alexanderporträt und zur ionischen Architektur erschien vor allem 1909 sein umfangreiches Buch über den berühmten Leuchtturm von Alexandria: »Pharos. Antike, Islam und Occident. Ein Beitrag zur Architekturgeschichte«. Die monumentale Arbeit enthält zugleich eine Geschichte der Minarette und der Moschee.
Die neue Zeit mit ihrer Technik hielt damals auch im Freiburger Institut ihren Einzug: Am 7. März 1901 wurde ein gemeinsamer Antrag »der Direktionen des Archäologischen und des Pharmacognostischen Instituts« auf »Anlage eines Skioptikons mit elektrischer Lampe im Hörsaal 29« gestellt. Ob das Gerät, der erste Diaprojektor, tatsächlich angeschafft wurde, ist den Akten nicht zu entnehmen. Möglicherweise war es nicht der Fall, denn Thierschs Antrittsrede mit »Skioptikon« fand am Donnerstag, den 30. November 1905, »um 61/2Uhr präcise« bei Ausfall aller übrigen Veranstaltungen im physikalischen Hörsaal statt. Thiersch stellte immer wieder neue Anträge auf Erhöhung des Aversums und Erweiterung des äußerst beschränkten Raumes. Ich zitiere aus einem Antrag vom 18. Januar 1907, dessen Wortlaut ich für meine eigenen unentwegten Anträge verwenden könnte: »Das bestehende Aversum ist ganz unzureichend. Ein fruchtbarer Ausbau des Instituts, welchen das Fach selbst wie die Frequenz der hiesigen Universität fordern, ist ohne eine beträchtliche Steigerung der regelmäßig zur Verfügung stehenden Mittel einfach unmöglich. Wer die Kostspieligkeit archäologischer Werke kennt und die Unmöglichkeit erfahren hat, die Anschaffung solcher Publikationen bei der allgemeinen Universitätsbibliothek zu erwirken, der wird sich der Erkenntnis nicht verschließen können, daß das Institut bei einer Fortdauer der jetzigen Aversumshöhe zu nicht mehr gutzumachender Rückständigkeit verurteilt würde«. Anderthalb Jahre später wurde vom Ministerium das Aversum von 1200 Mark auf 1700 Mark erhöht, weiteres abgelehnt. Ein Antrag von 1909 hatte noch weniger Erfolg. Ein Jahr später wurde im Einvernehmen mit dem jetzt berufenen Kunsthistoriker Wilhelm Vöge ein Antrag auf Trennung der Aversen des Archäologischen und des Kunsthistorischen Instituts gestellt. Thiersch fühlte sich durch die Einrichtung des kunsthistorischen Aversums im Ergebnis benachteiligt und protestierte erfolglos. Immerhin erhielt 1910 das Archäologische Institut mit 2300 Mark wesentlich mehr als das kunsthistorische mit 1400 Mark pro Jahr. Inzwischen hat sich dieses Verhältnis proportional gewiß umgekehrt. Thierschs Antrag von 1911, das Aversum von diesen 2300 Mark auf 3000 Mark zu erhöhen, hatte immerhin anderthalb Jahre später Erfolg. Thierschs Zähigkeit ist es auch zu verdanken, daß die Raumnot des Instituts halbwegs behoben wurde. 1907 befand es sich noch im alten Hauptgebäude, also im ehemaligen Jesuitenkolleg, der jetzigen Alten Universität, im 3. Stock und zwar zusammen mit dem althistorischen Seminar in einem einzigen Raum! Nach mancherlei Anderungsvorschlägen erhielten die Althistoriker einen daneben gelegenen Raum, so daß die Archäologen nun über einen eigenen verfügten. 1911 siedelten die Archäologen samt Althistorikern und Kunsthistorikern in die alte Universitätsbibliothek über, also in die Bertholdstr. 14. Hier befand sich bis zur Kriegszerstörung das Seminar, während die Archäologische Sammlung in der Alten Universität verblieb, das photographische Labor sich in der Bertholdstr. 17 befand und Vorlesungen im neuen Kollegiengebäude stattfanden. Ermutigt durch diese Verbesserungen wagte Thiersch am 7. Januar 1913 einen erneuten Antrag auf Erhöhung von jetzt 3000 Mark auf 4500 Mark. Bibliothek und Diathek (es gab schon 5000 Diapositive) seien »ziemlich auf der Höhe stehend«, die Erhöhung sei aber notwendig, um diese Höhe zu halten und auch die Photographie- und Abgußsammlung, wie es für den Unterricht erforderlich sei, aus ihrem dürftigen Bestand emporbringen zu können. »Die Freiburger Wissenschaftliche Gesellschaft hat mir zwar in entgegenkommendster Weise eine Summe von 1000 Mark zur Anschaffung von Gipsabgüssen bewilligt und eine zweite Rate von derselben Höhe als vielleicht möglich in Aussicht gestellt. Aber ich darf solche Gunst, die ich dankend für die seit sechs Jahren wieder ersten Gipsbestellungen verwenden werde, nicht sobald ein zweites Mal beanspruchen. Auch möchte ich bemerken, daß eine einzige lebensgroße Gipsfigur inklusive Transport durchschnittlich 300 Mark kostet...« Dann folgt ein Hinweis, den schon Feuerbach hätte geben können und der zu Thierschs Zeiten ebenso wie heute aktuell geblieben ist: »Noch darf ich darauf hinweisen, daß dem Heidelberger Schwesterinstitut, das unter meist günstigeren Verhältnissen sich entwicklen konnte, die von mir jetzt für Freiburg erbetene Aversumshöhe schon seit 5 Jahren zur Verfügung steht und seither noch um ein weiteres aufgehöht worden ist.« Es dauerte erneut anderthalb Jahre bis die Erhöhung kam, jedoch nicht auf 4500, sondern nur auf 3400 Mark. Dies war am 11. Juli 1914, unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 1918 war das Aversum auf 2500 Mark zusammengeschmolzen, das Geld ohnehin nicht mehr viel wert. 1918 erhielt Hermann Thiersch einen ehrenvollen Ruf nach Göttingen, den er gern annahm. In einem Brief vom 18. Januar 1918 an das Rektorat nennt er als einzigen Grund seines Weggangs das Göttinger Institut »wie es mir zur Verwirklichung meiner wissenschaftlichen Aufgabe dort vom ersten Tag an zur Verfügung steht in neuester Ausrüstung, ein für die ganze Lehrtätigkeit so glücklicher Umstand, wie er auch beim allerbesten Willen der Regierung (in Freiburg) vorerst gar nicht zu beschaffen ist.«
Noch Ende 1918 wurde der aus vier Kriegsjahren heimkehrende Erlanger Professor Ludwig Curtius nach Freiburg berufen21. Er war 1874 in Augsburg geboren, hatte zunächst ein Studium der Jurisprudenz und Nationalökonomie begonnen, ehe er sich seit 1897 unter dem Einfluß der Persönlichkeit Adolf Furtwänglers der Klassischen Archäologie zuwandte. Nebenher Erzieher der Söhne Furtwänglers und des Bildhauers Adolf von Hildebrandt, promovierte er 1902 in München und reiste anschließend mit dem noch heute begehrten Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts in Griechenland und Kleinasien, nahm an den Ausgrabungen von Bogazköy und Aigina teil und wurde nach seiner Habilitation in München bereits 1908 außerordentlicher Professor in Erlangen, 1913 ordentlicher. Ludwig Curtius war ein ungemein vielseitig interessierter und gebildeter, in persönlichem Umgang offenbar außerordentlich anregender Mensch. Seine Forschungen zur antiken Kunstgeschichte einschließlich der vorderasiatischen, zum römischen Porträt und zur pompejanischen Wandmalerei sind vielfältig, glänzend formuliert, wenn auch durch einen starken Subjektivismus bestimmt. In seinen sehr lesenswerten Lebenserinnerungen schildert er Freiburg nach dem ersten Weltkrieg: »Die Universität selbst stellte den größten Gegensatz zu Erlangen dar. War diese klein, eng, aber geschlossen und von einem gewissen einheitlichen Charakter, so hatte sich jene mit ihrem eleganten, aber modern-kühlen Kollegienhause, in dem ich nie heimisch wurde, unter der zielbewußten Universitätspolitik hervorragender Beamter des badischen Kultusministeriums ins Weite, beinahe Große ausgedehnt und zog Studenten aus allen Gauen Deutschlands an. Aber da diese Blüte erst einige Jahre vor dem Weltkrieg eingesetzt hatte - früher war Freiburg eine stille katholische Winkeluniversität gewesen - so hatte diese Alma mater keine Tradition, das studentische Verbindungswesen spielte an ihr kaum eine Rolle, und bald wurde auch die wunde Stelle in ihrem Aufbau sichtbar. Denn viele Studenten kamen gezogen, weniger um in unseren Hörsälen als in freier Luft bei »Professor Schauinsland« und »Professor Feldberg« zu hören, und wir hatten uns mit einer gewissen Resignation mit der Tatsache abzufinden, daß die netten norddeutschen Burschen, deren edle, offene, blonde Gesichter uns in den Bänken vor uns allmählich vertraut geworden waren, gerade dann,wenn es soweit war, erklärten, nun seien ihre zwei oder drei süddeutschen Semester verflossen und sie müßten wieder zu kühleren Pflichten zurückkehren. So fehlte Freiburg sozusagen das studentische Rückgrat. Der Schwarzwälder, im allgemeinen ein zwar echter, aber gedankenschwerfälliger, auch zahlenmäßig schwacher Typus, konnte dies nicht bilden. Auch die an ihr dickflüssiges Wohlleben gewohnte Einwohnerschaft der Stadt war wenig geneigt zu akademischer Resonanz, so daß später eine etwas vorwitzige Studentin, die Heidelberg mit Freiburg verglich, sagte, in diesem sei die Luft, dort aber die Atmosphäre besser.« 22Bereits im Sommer 1919 erhielt Ludwig Curtius einen Ruf nach Heidelberg, den er trotz Bemühungen um eine Verbesserung seiner Situation in Freiburg bald annahm. Der damalige Dekan Edmund Husserl schrieb mit eigener Hand am 6. Juni 1919 an den Rektor: »Die Philosophische Fakultät ist durch die Berufung des Herrn Prof. Curtius nach Heidelberg in eine schwierige Lage versetzt. Obschon Herr Curtius, wie er uns wissen ließ, den lebhaften Wunsch hat, in unserer Fakultät zu verbleiben, so sind doch die allbekannten und oft beklagten Übelstände des Archäologischen Instituts so weitgehende, daß er sich in seinen Lehr- und Forschungsmöglichkeiten unerträglich gehemmt sieht und schon den Ruf anzunehmen geneigt ist, es sei denn, daß ihm
die sichere Aussicht auf eine Besserung dieses Übelstandes eröffnet wird. Überhaupt ist, so lang diese Verhältnisse keine wesentliche Änderung erfahren, an eine dauernde Besetzung des archäologischen Lehrstuhls durch eine wertvolle Kraft nicht zu denken ...« Die wohl etwas unrealistische Fakultät schlug in demselben Brief vor, daß die Wirtschaftsdeputation 100.000 Mark aus dem Grundstock zur Verfügung stelle und den Erwerb einer Liegenschaft auf der Südseite der Alten Bibliothek ins Auge fassen möge. Daraus ist natürlich nichts geworden. Zwei Tage später wandte sich Curtius selbst an das Rektorat: »Die vom Archäologischen Institut in der Alten Universität als Abgußmuseum benützten Räume sind feucht, schmutzig, schlecht beleuchtet, kalt, zu klein - unzulänglich in jeder Beziehung. Die Abgußsammlung in ihrer gegenwärtigen Aufstellung scheidet für Lehr- und Studienzwecke gänzlich aus ... Die einzige Lösung, ein besonderes Museum für Abgüsse zu errichten, wird von mir seit meinem Amtsantritt im Herbst 1918 energisch angestrebt.« In derselben Lage befand sich sein Amtsnachfolger in den frühen achtziger Jahren noch immer, sogar heute noch. Dabei war es Curtius gelungen, noch Ende 1918 von privater Seite, wie es heißt, 25.000 Mark aufzubringen, mit denen »38 kleine antike Marmorwerke« aus der Sammlung des Kunsthändlers Paul Arndt in München samt mehreren hundert Fragmenten griechischer Vasenscherben erworben werden konnten. Von diesen 38 Marmorwerken hat keines, wie es scheint, den Zweiten Weltkrieg überlebt, von den Scherben zwar die Mehrzahl, aber ohne die wirklich bedeutenden Stücke.
Mit dem 1. März 1920 trat der damals 35-jährige Ernst Buschor in Freiburg an23. Er hatte 1904 bis 1912 in München wie Curtius zunächst Jura, dann, ebenfalls unter dem Einfluß Adolf Furtwänglers, klassische Archäologie studiert, 1907 und 1908 die Lehramtsprüfungen abgelegt und 1912 promoviert. Mit einer Unterbrechung durch dreieinhalbjährigen Kriegsdienst war er bis 1919 Assistent und Kustos am Museum für Abgüsse in München, danach für ein knappes Jahr Curtius' Nachfolger in Erlangen und schließlich für nicht einmal zwei Jahre in Freiburg. Buschor wurde bereits 1921 zum Direktor der wiedereröffneten Athener Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts berufen, von wo aus er die Samosgrabung leitete, was er auch später als Münchner Ordinarius bis zu seinem Lebensende tat. In seinem Abschiedsschreiben an den Rektor der Freiburger Universität vom 22. Dezember 1922, bereits aus Athen, heißt es: »... nur die ganz außerordentlichen Schicksale unseres Vaterlandes und des Deutschen Archäologischen Instituts konnten mich veranlassen, der einzig schönen Lehrtätigkeit an der Freiburger Universität zu entsagen.«
Auch Buschor war nicht faul gewesen, in Freiburg Anträge zu stellen. Am 30. Juni 1920 beantragte er die Erhöhung seiner Berufungszusage um 3000 auf 10.000 Mark »mit Rücksicht auf die Entwertung des Geldes«. Es heißt weiter: »Schon bei meinem Amtsantritt habe ich auf die außerordentlichen Schwierigkeiten hingewiesen, die das Fehlen einer auch nur einigermaßen ausreichenden Gipssammlung und das fast völlige Fehlen von Photographien bedeutet. Während meiner hiesigen Tätigkeit habe ich diese Lücken erst in ihrer vollen Bitterkeit kennengelernt und verstehen gelernt, was meinen Vorgänger von hier vertrieben hat: Es fehlt auf Schritt und Tritt für Forschung und Lehre das Instrument, das sich auch kleinere Universitäten vor dem Krieg zu verschaffen nicht versäumten und das unter den jetzigen Verhältnissen nicht ohne Zuschüsse zum Aversum beschafft werden kann.« Schon im Mai 1923, also unter seinem Nachfolger Dragendorff, betrug das Aversum jährlich 1 Million Mark, im Oktober 1923 mit Beginn des laufenden Rechnungsjahres 8 Milliarden 500 Millionen Mark!
Buschors Weggang von Freiburg war erneut ein schwerer Verlust. Curtius bezeichnete ihn später als »radikal-modernen« Menschen24. Er brach mit dem gelehrten Positivismus der Vorgänger, sah die antike Kunst mit frischen Augen und formulierte in einer neuen Sprache ihre existentielle Herausforderung an die junge Kriegsgeneration. Der Expressionismus wurde hier unmittelbar in der Archäologie fruchtbar. Buschor hat die Archaik neu sehen gelehrt, was ihm freilich in Griechenland eher möglich war als in dem kleinen Freiburg. Als sein Nachfolger kam zum 1. April 1922 Hans Dragendorff, bereits 51 jährig, der, 1870 in Dorpat geboren, nach seinem Studium in Dorpat, Berlin und Bonn 1894 in Bonn bei Georg Loeschke promoviert und danach eine glänzende Karriere gemacht hatte25. Nach Stipendiatenjahren wurde er bereits mit 27 Jahren außerordentlicher Professor in Basel und von 1902 bis 1911 Gründungsdirektor der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts in Frankfurt. Dragendorff war ein bahnbrechender Forscher auf dem Gebiet der provinzialrömischen Archäologie und ist dies auch Zeit seines Lebens geblieben. Von 1911 bis 1922 war er in Berlin Generalsekretär des Deutschen Archäologischen Instituts, gleichzeitig Mitglied der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Freiburg war also seine letzte Station, er ruhte sich hier aber nicht aus. Schon 1928 wurde er zum Rektor für das Akademische Jahr 1929-30 gewählt und bald um ein zweites Jahr verlängert. Die Freiburger Zeitung schrieb im Oktober 1930 zu seinem 60. Geburtstag: »... als charakterfester Mann und Verfechter der den Hochschulen eingeräumten Rechte bewährte er sich in jener Zeit, da man an ihnen zu rütteln suchte«. Nach vielen weiteren wissenschaftlichen Ehrungen und mancher Aktivität - 1925 findet man zum ersten Mal einen Zuschuß zu einer Exkursion nach Oberitalien - wurde er 1936 entpflichtet. Zu seinem 70. Geburtstag 1940 machte ihn der Senat zum Ehrenbürger der Universität, eine bis dahin nie verliehene Ehre. Begründet wurde sie, abgesehen von seiner akademischen Leistung in Forschung, Lehre und Verwaltung, mit seiner Mitarbeit im Studentenwerk, der Leitung des Vereins der Freunde und Förderer der Universität und als Mitglied des Kuratoriums der Freiburger Wissenschaftlichen Gesellschaft. Noch nach seiner Emeritierung betrieb Dragendorff die Ausgrabung der römischen Villa bei Laufenburg und übernahm von 1939 bis zu seinem im Januar 1941 erfolgten Tode sogar vertretungsweise die Leitung der Römisch-Germanischen Kommission in Frankfurt.
Das kleine Archäologische Institut bestand aber längst nicht mehr nur aus seinem Ordinarius und ein paar Hilfskräften. Schon neben Buschor und in seiner Vertretung wirkte als Dozent Bernhard Schweitzer, der nachmalige Leipziger und Tübinger Ordinarius (1892-1966)26. Unter Hans Dragendorff war Anfang der Dreißiger Jahre für kurze Zeit der Wiener Guido von Kaschnitz-Weinberg (1890-1958) tätig. Marie Luise Kaschnitz schreibt darüber in ihrer »Biographie Guido Kaschnitz-Weinberg«: »Als er sich im Januar 1932 bei Hans Dragendorff habilitiert hatte und seine ersten Vorlesungen hielt, wohnten wir auf dem Gut meiner Eltern in Bollschweil im Hexental, wohin es damals nur eine spärliche Autobusverbindung gab. Kaschnitz mußte den zweistündigen Heimweg zu Fuß machen, und ich erinnere mich gut, mit welchem Entzücken ihn dieser auf die Berge zuführende abendliche Weg jedesmal erfüllte. Er fand in Freiburg in seinem Ordinarius Dragendorff, vor allem aber in den jüngeren Professoren, dem Kunsthistoriker Bauch, dem Altphilologen Schadewaldt und dem Historiker Heimpel neue Freunde und in dem schönen alten Seminargebäude in der Bertholdstraße eine rechte Heimat und wäre damals am liebsten lange in Freiburg geblieben.«27 Das Thema seiner Habilitation war »Die Struktur der griechischen Plastik«. Strukturanalysen haben Kaschnitz von Weinberg sein Leben lang beschäftigt, sei es auf den Lehrstühlen in Königsberg, in Marburg oder in Frankfurt und schließlich als erster Direktor nach dem Krieg am Deutschen Archäologischen Institut in Rom.
Ein weiterer Wissenschaftler, der sich 1933 bei Dragendorff habilitierte, verdient Erwähnung: Werner Technau (1902-1941).28 Er hatte sich von Ludwig Curtius zur klassischen Archäologie begeistern lassen, bei ihm 1926 in Heidelberg promoviert und hatte dann glückliche Jahre als Stipendiat in Griechenland und als Assistent in Rom verbracht. Außer wichtigen Beiträgen zur griechischen Vasenmalerei sei seine 1940 erschienene »Kunst der Römer« erwähnt, nach Ludwig Curtius »der beste Abriß der römischen Kunst, den wir einstweilen besitzen«29. Zwischen 1933 und der erst 1940 erreichten Dozentenstelle mußte Werner Technau sich, seine Frau und vier Kinder mit einem mageren Stipendium der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft über Wasser halten. 1941 starb er an der russischen Front.
Trotz aller bedeutenden Vorgänger hat am nachhaltigsten das Freiburger Institut geprägt Walter-Herwig Schuchhardt30, der im November 1936 als Vertreter Dra-gendorffs, vom 1. Januar 1937 bis zum 31.März 1968 Ordentlicher Professor in Freiburg war. Am 8. März 1900 als Sohn des Prähistorikers und Museumsdirektors Carl Schuchhardt in Hannover geboren, promovierte er bereits mit 23 Jahren nach einem Studium in Tübingen, Göttingen und Heidelberg bei Hermann Thiersch in Göttingen über »Die Meister der pergamenischen Gigantomachie.« Zunächst Assistent in München, dann Reisestipendiat, war er von 1925 bis 1929 Assistent in Athen. Nach seiner Habilitation über den Parthenonfries und die Weihereliefs des 5. Jahrhunderts v. Chr. wirkte er an der Universität Frankfurt bis 1933, dann für ein Jahr in Griechenland, ein weiteres Jahr als außerordentlicher Professor in Gießen. Schuchhardt, der seit 1929 mit Helga Wolf aus Basel verheiratet war und vier Kinder hatte, mußte sich in Freiburg wohl zunächst recht krumm legen. Sein Monatsgehalt im Jahr 1936 betrug ganze 584,73 Reichsmark. Auch mit dem Etat und der Entwicklung der Abgußsammlung sah es nicht gut aus. 1937 hatte, vergleichbar der Situation von 1821, die Abgußsammlung der forstlichen Abteilung einen Raum zu opfern. Notwendige Zuschüsse gab es nur für die Neuaufstellung der beengten Gipssammlung. Im Juli 1938 konnte Schuchhardt aber an das badische Kultusministerium schreiben: »Es war uns eine freudige Genugtuung, am Tage der Philosophischen Fakultät einen ganz ungewöhnlichen Andrang des Publikums in der Führung durch die Gipsabgußsammlung feststellen zu können. Drängten sich doch etwa 400 Besucher zusammen, um von der ihnen bis dahin unbekannten Existenz einer Gipsabgußsammlung nach klassischen Kunstwerken eine Vorstellung zu erhalten. Der Widerhall in der Presse zeigte deutlich, daß dieses Interesse nicht nur eine vorübergehende Neugier darstellte. Ich gehe daher mit dem Gedanken um, die Sammlung an einem Tage der Woche öffentlich zugänglich zumachen.« Daraus ist wegen des Krieges natürlich nichts geworden. Die Sammlung im Keller der Alten Universität wurde durch die Bomben des Jahres 1944 total zerstört. Am 26. Januar 1945 beantragte Schuchhardt beim Rektorat 800 Reichsmark für Bergungszwecke, die er auch erhielt: »Ein Teil der Archäologischen Sammlung steht in Kisten verpackt im Keller und muß baldigst geborgen werden.« Auch das schöne alte, enge Institut in der Bertholdstr. 14 sank am Ende des Krieges in Schutt und Asche. Zuvor war dort freilich der Mangel zu verwalten. Und Verdrießlichkeiten, die geradezu an spätmittelalterliche Verhältnisse erinnern, kamen dazu: Schuchhardt mußte am 1. Juli 1942 an das Rektorat schreiben: »In der vergangenen Woche wurde verschiedene Male wie auch vorher schon in einigen Fällen, quer über das Gartengrundstück des Gebäudes der Alten Bibliothek, Bertholdstr. 14, mit Schrotladungen auf die Fenster des kunsthistorischen Instituts geschossen ...« Der ebenfalls von Schrotschüssen verfolgte Hausmeister fand bald heraus, daß der Sohn der im Hinterhaus wohnenden Familie Gleitzmann dafür verantwortlich sei. Schuchhardt erklärte sich diese seltsamen Feindseligkeiten aus dem Umstand, daß Familie Gleitzmann »vor zwei Jahren aus grundsätzlichen Erwägungen jede Benutzung des Hofes der Alten Bibliothek zum Einstellen eines Marktstandes und anderer Gegenstände abgeschlagen wurde«. Am 23. Dezember 1943 mußte er an das Bezirksbauamt schreiben: »Teile ich mit, daß, wenn auch von der Frau Gleitzmann nicht einiges Geflügel auf Dauerzustand gehalten wird, sich doch lebendes Geflügel dauernd in dem von der Universität abgetretenen Hofstück befindet. Es macht sich dieses Geflügel nicht nur von dem Hofstück aus in jeder Weise bemerkbar, sondern es fliegen auch täglich zwei oder drei Tiere in den Hof des Universitätsgebäudes Bertholdstr. 14, die dann mit großem Aufwand wieder eingefangen werden müssen.«
Schuchhardt konnte nach dem Krieg durch mehrfache Ablehnung von Rufen nicht nur seine persönlichen Bezüge, sondern auch die Ausstattung des so schwer beeinträchtigten Institutes laufend verbessern. Schon 1939 hatte er den Ruf als Thierschs Nachfolger nach Göttingen abgelehnt, 1946 einen nach Kiel. Erneut wurde er 1958, diesmal nach Hamburg, berufen und 1960 nach Wien. Alle diese Rufe hat er zugunsten Freiburgs abgelehnt und so dem Institut allmählich neue Stellen und Mittel für Bibliothek, Photothek und Diathek verschafft. Nur für eine neue Abgußsammlung blieb kaum etwas übrig, sieht man von der Überlassung einer größeren Anzahl Abgüsse durch die Karlsruher Akademie der Bildenden Künste ab, wo solche altmodischen Dinge von den jungen Adepten der modernen Kunst verachtet wurden.
Schuchhardt war auch in der Akademischen Selbstverwaltung sehr aktiv. Von 1941 bis 1945 war er Dekan der Philosophischen Fakultät, obwohl oder weil er niemals in der Partei war und in einem geschickten Kurs so viel Liberalität wie möglich an der Universität zu bewahren suchte. Im Oktober 1945 zunächst wegen gewisser Anfeindungen von den französischen Militärbehörden suspendiert, wurde er doch schon einen Monat später wieder in die Universität aufgenommen. Bereits 1946 war er wieder als Prodekan tätig und von da an bis 1958 Leiter des Akademischen Auslandsamtes. Schließlich wurde er zum Rektor für das Akademische Jahr 1953/54 gewählt. Ferner war er lange in der Baukommission der Universität tätig. 1967 wurde er Mitglied der Heidelberger Akademie und 1968 schließlich entpflichtet. Danach blieb er unvermindert wissenschaftlich tätig, bis er am 14. Januar 1976 einer Operation erlag. Schuchhardt war, wie ich noch selbst als sein Schüler bezeugen kann, ein hinreißender Redner und Interpret der griechischen Kunst, vor allem der Plastik. Er vereinigte in sich preussische Strenge und vornehme Unnahbarkeit einerseits, beißenden Humor und ausgelassene Heiterkeit vor allem bei den Festen und Gesellschaften, die in seinem gastlichen Haus auch dank seiner hochmusikalischen Frau, aber ebenso im Institut stattfanden. Schuchhardt zog zumal in seinen letzten Jahren viele Schüler nach Freiburg, wo fast ausschließlich die griechische Plastik im Mittelpunkt des Interesses stand. Das Übrige überließ er gerne seinen Mitarbeitern, dem Lehrbeauftragten Joseph Wiesner oder seinem Assistenten Felix Eckstein. In einem Nachruf schrieb Hans Weber, Schuchhardts Nachfolger, in der Badischen Zeitung vom 17. Januar 197Ä, wobei er ihn mit seinem Vater Carl Schuchhardt verglich: »... der Sohn hat die fachlichen Grenzen für seine Person enger gezogen, dafür den bildungsmäßigen Horizont auf eine bewundernswerte Höhe gehoben. Der Name Goethe war für Schuchhardt ein Zentrum seines geistigen Wesens.« Drei Tage später konnte man in der Frankfurter Allgemeinen im Nachruf des Schuchhardt-Schülers Hans von Steuben lesen: »... Schuchhardt war die unbestrittene Autorität auf dem Gebiet der griechischen Plastik ... Für ihn schien die antike Lehre zuzutreffen, daß Gleiches nur durch Gleiches erkannt werde. Was ihm nicht gemäß war, darum hat er sich auch nicht bemüht, mit dem Recht dessen, der ein großes Talent und eine große Liebe hat. Schuchhardts Liebe galt allein der Kunst in ihren höchsten Formen, also der griechischen. Schon die römische war ihm fremd, und eine Beschäftigung mit provinziellen oder primitiven Erscheinungen, aus historischem oder soziologischem Interesse, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Er hat auch nie darauf verzichtet, in der griechischen Kunst die klassische zu sehen ...« Auf Schuchhardt folgte Hans Weber, der, 1913 in München geboren, seine Prägung von der Jugendbewegung und durch Ernst Buschor empfing31. Nach Studien in Heidelberg, Frankfurt und München promovierte er 1938 bei Buschor. Das ihm für 1939/40 verliehene Reisestipendium konnte er wegen des Krieges nicht antreten, doch war er von 1938 bis 1944 regelmäßig an den Grabungen in Olympia beteiligt und tat sich mit Studien zur Architektur und Topographie sowie zum kaiserzeitlichen Porträt, zwei Leitthemen seiner späteren wissenschaftlichen Tätigkeit, hervor. 1944 in Straßburg Assistent bei Emil Kunze, mußte er den Tod seiner ersten Frau kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes erleben. Seit 1948 in Kiel, habilitierte er sich dort 1956 mit leider unpubliziert gebliebenen »Untersuchungen zur Bildniskunst Griechenlands in hadrianischer Zeit«. Im selben Jahr heiratete er die Archäologin Martha Gercke, die unter uns ist und seit langem als aktive Wissenschaftlerin, Lehrbeauftragte und als Gesprächspartnerin vor allem der Studenten eine wichtige Rolle in unserem Institut spielt. Nach einigen Jahren bei der Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin wurde Hans Weber Zweiter Direktor der Abteilung Istanbul, wo er zweifellos seine glücklichsten Jahre im Wechsel zwischen Redaktions- und Forschungsarbeiten verbrachte. 1968 erhielt er gleich drei Rufe: nach Kiel, Hamburg und Freiburg. Er entschied sich für Freiburg, wo er bis zu seiner Emeritierung 1980 wirkte, immer stärker behindert durch seine schwere Zuckerkrankheit, mit der er seit seiner Jugend zu leben gelernt hatte. Webers Sparsamkeit, ja Askese wird darin ihren Grund haben. Von seinen Studenten wurde immer wieder seine intensive Lehre und seine echte Herzensgüte gepreisen. Ich selbst konnte ihn wenigstens noch einige Wochen in Freiburg erleben, ehe er am 4. Mai 1981 friedlich entschlief.
Es gehört zu Hans Webers Verdiensten, das Archäologische Institut in seine jetzigen Räume auf dem Dach des Kollegiengebäudes III gebracht zu haben, wo freilich die Terrassen ausgedehnter sind als die Institutsräume. Nach dem Krieg war das Institut bis zum Ende der Fünfziger Jahre unter beengten Verhältnissen im Augustinermuseum untergebracht, dann für wenige Jahre im Haus Werderstr. 14. Schließlich kam es von 1962 bis 1970 hinter die Gitter des Kollegiengebäudes II. Unstreitig sind wir seit 20 Jahren das Institut mit den schönsten Aussichten, freilich auch immer beengteren Raumverhältnissen! Denn in den letzten zehn Jahren sind Bibliothek und Diathek beträchtlich gewachsen, hat die Zahl der Studenten und Lehrkräfte und Projekte bedeutend zugenommen. Auch die Archäologische Sammlung ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. 1981 wurde unter dem Vorsitz des Freiburger Mäzens Franz A. Morat der Freundeskreis der Archäologischen Sammlung gegründet, ein Jahr später konnten, gewissermaßen als Vermächtnis Walter-Herwig Schuchhardts, die Ergebnisse einer von ihm noch begonnenen Arbeit an den Fragmenten römischer Gipsabgüsse griechischer Originalstatuen aus Baiae am Golf von Neapel, die von seiner Schülerin Christa Landwehr umsichtig zuende geführt worden ist, in einer aufsehenerregenden Ausstellung präsentiert werden. Dies war meines Wissens die erste Antikenausstellung, die je in Freiburg präsentiert worden ist. Nach langjährigen Kämpfen um einen geeigneten Aufstellungsort konnte dann 1988 endlich die durch wertvolle Leihgaben vor allem der Sammlung Morat bereicherte Archäologische Sammlung, vornehmlich Gipsabgüsse von Skulpturen aller antiken Epochen, im Erdgeschoß der Universitätsbibliothek als öffentliche Ausstellung eröffnet werden. Die Archäologische Sammlung hat einen bedeutenden didaktischen Wert, es finden dort laufend Lehrveranstaltungen, Zeichenkurse für Studenten und Führungen für ein allgemeines Publikum statt, bei denen unsere Studenten lernen, ihr selbst erst gelerntes Wissen geschickt zu vermitteln. Freilich sind wir zu ständigem Wechsel der Objekte gezwungen, da Sie in der Ausstellung nur einen Bruchteil unserer Schätze betrachten können. Im Tiefkeller des Kollegiengebäudes III harren über 400 weitere Abgüsse ihrer Erlösung von den Abgasen der benachbarten Tiefgarage und aus der Feuchtigkeit, weil der undichte Raum nach starken Regenfällen in eine große Pfütze verwandelt wird. Seit 6 Jahren ist mir die bisher von den Physikern genutzte kleine Fabrikhalle im Glacisweg als Studiensammlung und Werkstatt zugesagt, die fertigen Umbaupläne hätten in diesem Jahr realisiert werden sollen, sind aber um zwei Jahre verschoben worden. Geradezu als Geschenk zum Jubiläum hat mir nun die Oberfinanzdirektion Hoffnung gemacht, daß mit dem Umbau nun doch schon in einem Jahr begonnen werden könne32. Obwohl also das Archäologische Institut in den letzten zwei Jahrzehnten weder mehr Raum und kaum mehr Geld erhielt (der seit zehn Jahren stagnierende kümmerliche Etat von DM 34.000 entspricht inzwischen nurmehr rund 5 % der jährlich eingeworbenen Drittmittel, ein groteskes Mißverhältnis33) - trotz dieses Mißstandes hat sich nicht nur das Lehrangebot vermehrt und ist sehr vielseitig geworden, auch die Forschungspalette hat sich außerordentlich verbreitert. Während unter Schuchhardt der Schwerpunkt der Forschung ganz auf dem Gebiet der griechischen Plastik lag, brachte Hans Weber seine Interessen an griechischer Archi-
tektur mit ein. Neben Schuchhardt und Weber wirkten allerdings auch Assistenten und Dozenten auf neuen Gebieten: Die Erforschung der römischen Kunst als Ausdruck politischer Ideologie wurde in den siebziger Jahren von Paul Zanker in Angriff genommen, die Archäologie der mykenischen und minoischen Epoche von Gerhard Hiesel. Nun beschäftigen wir uns auch mit römischer Wandmalerei und Architektur innerhalb des Pompeji-Projektes, bei dem mich Wolfgang Ehrhardt und zwei Graphikerinnen wesentlich unterstützen. Weiter hat Cornelia Weber-Lehmann ein Dokumentationsprojekt für die etruskischen Gräber in Tar-quinia in Angriff genommen, werden Forschungen zur antiken Numismatik und zu Gemmen und Kameen von Götz Lahusen und Wolf-Rüdiger Megow betrieben. Durch Wolf-Dietrich Niemeier hat die ägäische Archäologie nun auch eine eigene Grabung, nämlich Tel Kabri in Israel, während Renate Preißhofen mit ihren Praxiteles-Forschungen, Martha Weber mit Studien zu den Amazonenstatuen und Götz Lahusen mit der kunsthistorischen sowie technischen Analyse römischer Großbronzen den alten Schwerpunkt behaupten. An Lehrbeauftragten, die natürlich auf vielen verschiedenen Feldern auch forschend tätig sind, möchte ich dankbar die Herren Cahn, Ganschow, Jakobs und nicht zuletzt Vollkommer nennen.
Einer fehlt seit drei Jahren in dieser Reihe der Kollegen: Felix Eckstein, der wie kein anderer außer Schuchhardt mit diesem Institut verwachsen war und es geprägt hat. 1925 in Freiburg geboren, begann er in aussichtsloser Zeit sein Archäologiestudium mit dem Wintersemester 1945/46. Nach Studien in Marburg und München, promovierte er 1950 über Stilleben in der pompejanischen Wandmalerei. Sein Stipendiatenjahr und seine mehrjährige Teilnahme an der Olympiagrabung bestimmten dann die griechische Kunst und Kultur zu seinem künftigen Forschungsgebiet. Zu einer von Schuchhardt geprägten Virtuosität der Stiluntersuchung trat ein eigenes ikonographisches, religionswissenschaftliches und antiquarisches Interesse. Neben etlichen Abhandlungen auf diesen Gebieten, vielen Lexikonartikeln und Rezensionen gab er seit 1962 zunächst als Redakteur das von Walter-Herwig Schuchhardt initiierte große Lieferungswerk »Antike Plastik« heraus. Seit 1972 war Eckstein selbst der Herausgeber. Insgesamt zwanzig Bände sind unter seiner Ägide erschienen. Neben dieser umfangreichen Tätigkeit in Forschung und Lehre fand Eckstein Zeit und Kraft, nach einem Dekansjahr das Amt des Prorektor für Studien- und Prüfungsangelegenheiten von 1971 bis 1983 wahrzunehmen. Eine tückische, langjährige Krankheit, die er mit bewundernswerter Geduld ertragen hat, führte am 13. Januar 1988 zu seinem viel zu frühen Tod. Sein letztes Werk, einen gelehrten Kommentar zur Beschreibung Griechenlands durch den antiken Autor Pausanias konnte er nicht mehr vollenden. Sein Schüler Peter Cornelius Bol übernahm diese pietätvolle Aufgabe in kürzester Zeit, so daß seit längerem die drei Bände des Pausanias vorliegen.
Es ist mir eine besondere Freude, daß Professor Bol aus Frankfurt, dem wir neben vielen anderen bedeutenden Publikationen vor allem zur griechischen und römischen Skulptur auch die Idee und Organisation der so erfolgreichen Polyklet-Aus-stellung verdanken, nun den Festvortrag halten wird. Sein Thema »Pausanias und die griechische Plastik« ist dem Freiburger Institut von Eckstein über Schuchhardt zurück bis zu Anselm Feuerbach besonders angemessen.
| * | Ungekürzter, um Anmerkungen erweiterter Text des Vortrags, der beim Festakt am 19. Februar 1991 an der Universität Freiburg gehalten wurde. |
| 1 | Dank des freundlichen Entgegenkommens von Frau Beatrix Klaiber konnte ich im Universitätsarchiv die dorthin gelangten Akten des Archäologischen Instituts sowie die Personalakten der Professoren außer der verschollenen von Ludwig Curtius einsehen. Im folgenden zitiere ich daraus ohne weitere Nachweise. |
| 2 | H. Mayer, Geschichte der Universität Freiburg in Baden in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts II (1893) 56. |
| 3 | Mayer a.O. III (1894) 5; O. Hense in: Die Universität Freiburg seit dem Regierungsantritt seiner Königl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden (1852-1881) (1881) 70. |
| 4 | H. Feuerbach, Anselm Feuerbachs Leben, Briefe und Gedichte. Nachgelassene Schriften von Anselm Feuerbach I (1853); J. Sengler, Gedächtnisrede auf Anselm Feuerbach, Großh. Bad. Hofrath und Professor der altclassischen Philologie, bei dessen academischer Todtenfeier in der Universitätskirche zu Freiburg am 15. Dezember 1853 (1853); H. Uhde-Bernays, Henriette Feuerbach. Ihr Leben in ihren Briefen (1912); G. Radbruch, Gestalten und Gedanken. Zehn Studien (1954) 125 ff. (Die Feuerbachs. Eine geistige Dynastie). |
| 5 | Radbruch a.O. 132 f. |
| 6 | A. Feuerbach, Der Vaticanische Apoll. Eine Reihe archäologisch-ästhetischer Betrachtungen (1833, 21855). |
| 7 | H. Feuerbach Anselm Feuerbachs Leben... (s.o. Anm. 4) 46. |
| 8 | Gutachten vom 24. Februar 1836 |
| 9 | H. Feuerbach, Anselm Feuerbachs Leben... (s.o. Anm. 4) 103f. |
| 10 | Ebenda 59 f. |
| 11 | H. Uhde-Bernays, Henriette Feuerbach. Ihr Leben in ihren Briefen (1912) 53 (Brief an Christian Heydenreich vom 26. Mai 1841). |
| 17 | Lullies-Schiering a.O. 118 f. (D. Mertens). |
| 18 | L. Wickert, Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts 1879 bis 1929. Das Deutsche Archäologische Institut. Geschichte und Dokumente 2 (1979) 11. |
| 19 | L. Curtius, Deutsche und antike Welt. Lebenserinnerungen (1950, hier nach der Sonderausgabe »Bücher der Neunzehn« von 1958) 205 f. |
| 20 | Lullies-Schiering a.O. 183f. (K. Fittschen). |
| 21 | Lullies-Schiering a.O. 186f. (R. Lullies). |
| 22 | Curtius a.O. 234f. |
| 23 | Lullies-Schiering a.O. 234f. (K. Schefold). |
| 24 | Curtius a.O. 298. |
| 25 | Lullies-Schiering a.O. 179f. (G. Grimm). |
| 26 | Lullies-Schiering a.O. 258f. (W. Fuchs). |
| 27 | Marie Luise Kaschnitz, Gesammelte Werke (hrsg. von Ch Büttrich und N. Miller) VI (1987) 809. |
| 28 | Lullies-Schiering a.O. 287f. (W. Schiering). |
| 29 | L. Curtius in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 57, 1942, S. II. |
| 30 | Lullies-Schiering a.O. 278f. (H. von Steuben). |
| 31 | Lullies-Schiering a.O. 317f. (V. M. Strocka). |